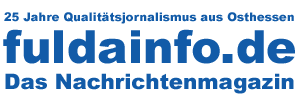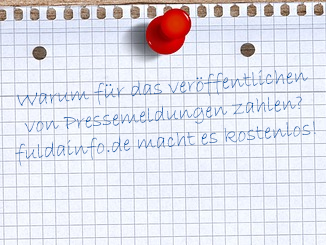Der politische Frühling um die bürgerliche Revolution von 1848/49 beflügelte auch die Hoffnungen auf bürgerliche Gleichstellung der Juden auf lokaler und nationaler Ebene. Im Oktober 1833 hatte die kurhessische Ständeversammlung nach über einjähriger Debatte das „Gesetz zur gleichförmigen Ordnung der besonderen Verhältnisse der Israeliten“ beschlossen. Damit erhielten die Juden in Hessen-Kassel – also auch in Fulda – die bürgerliche Gleichstellung. Die vorigen Sonderregelungen wie Schutzgeldzahlungen und Sondersteuern wurden aufgehoben. Ausgenommen blieben zunächst die „Nothandel“ treibenden jüdischen Hausier-, Leih- und Trödelhändler, die immerhin 10 Prozent der jüdischen Bevölkerung ausmachten.
Die jüdische Gemeinde von Fulda selbst war im Vorfeld mit einer Petition an den Stadtrat aktiv geworden und hatte die vollständige bürgerliche Gleichstellung gefordert: „Es wird sehr zu wünschen sein, dass die zweifelhaften Verhältnisse der Israeliten, welche den jetzigen Zeitumständen nicht mehr anpassend sind … geordnet werden“, schrieben die Vorständen Julius Jüdel, Moses Wiesbaden und Daniel Epstein im Mai 1832 an den Stadtrat mit der Forderung, in diesem Sinne gegenüber der Ständeversammlung aktiv zu werden. Der Magistrat wandte sich daraufhin an die Ständeversammlung, den Landtag in Kassel, mit der Forderung um baldige Regulierung der „judenschaftlichen Verhältnisse“, damit „nach den allgemeinen Menschenrechten und auch gemäß den Pflichten des Christentums den bisher nur geduldeten Israeliten ein gesicherter Rechtszustand garantieret und gesetzlich verankert werde“ und „auch alle unredlichen Schranken bei dem einmal würdigen, künftigen freien Bürger verschwinden zu lassen“.
Die Forderungen nach Gleichberechtigung waren auch ein zentrales Element der bürgerlichen Revolution von 1848/49. So auch in der programmatischen Rede des liberalen jüdischen Abgeordneten Gabriel Riesser in der Frankfurter Nationalversammlung im August 1848. Seinem Appell, „die Juden werden immer begeistertere und patriotischere Anhänger unter einem gerechten Gesetze werden. Sie werden mit und unter den Deutschen Deutsche werden,“ schlossen sich die Delegierten dem Anliegen der uneingeschränkten Emanzipation der Juden an und nahmen im März 1849 die rechtliche Gleichstellung der jüdischen Bürger im § 146 in die demokratische Paulskirchenverfassung auf.
Mit den bürgerlichen Rechten für die Juden galten für sie auch die Pflichten. Das Fuldaer „Verzeichnis der zur Bürgergardepflichtigen hiesigen Einwohner“ vom Oktober 1832 listet sämtliche jüdischen wehrpflichtigen Männer auf. Von den 35 jüdischen Mitgliedern der Bürgergarde gehörten auch vier zur 40 Mann starken Reitenden Bürgergarde. Es entsprach der Stimmungslage auch innerhalb der Fuldaer Juden, sich in den republikanisch paramilitärischen Vereinigungen zu engagieren, die die revolutionären Ziele und Errungenschaften der politischen Entwicklungen von 1848 befürworteten. Unter den 31 Gründungsmitgliedern der im April 1848 gegründeten republikanischen „Fuldaer Turnerschaft 1848“ befanden sich alleine sieben einflusseiche Fuldaer Juden: Josef Markheim, Hirsch Löser, azar Spiro, Michel Löser, Michael Epstein, Simon Hessdörfer und Lazar Lehnheim. Die Turnerschaft war paramilitärisch organisiert, trug Uniform und stand unter Waffen. Laut seinen Statuten wollte der Verein es „sich angelegen sein lassen, seine Mitglieder regelmäßig in den Waffen zu üben, um so die Hand zu einer allgemeinen Volksbewaffnung zu bieten“. Gleichzeitig verstand sich der Verein darin, „eine tüchtige politische Bildung seiner Mitglieder zu erzielen …, so dass sich dieselben als tatkräftige Söhne des gemeinsamen Vaterlandes fühlen und für Freiheit und Gesetz zu kämpfen bereit sind“. Als militärische Formation übten sich die Turner in kleinen Manövern, führten Übungsmärsche und Schießübungen durch und waren in die nächtlichen Patrouillendienste in Fulda zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Sicherheit eingeteilt. Jüdische Bürger aus Fulda waren auch im seit April 1848 bestehenden „Schutzverein“ vertreten, der sich die Aufgabe gestellt hatte, „zur Sicherheit der Personen und des Eigentums mitzuwirken. Aufnahmeberechtigt waren nur beruflich selbständige Bürger, die nicht bürgergardepflichtig waren, was den Altersdurchschnitt der über 60-Jährigen erklärt. „Turnerschaft“ wie „Schutzverein“ hatten in der Bürgergarde ein gemeinsames Oberkommando.
Wie notwendig diese Maßnahmen waren, zeigte sich im benachbarten Kreis Hünfeld. In der Gemengelage von Missernten, Hungerkrawallen und Revolutionswirren, die die staatliche Ordnung zeitweise destabilisierten, wurden die Juden zur Zielscheibe bäuerlichen Unmutes. In den Dörfern Burghaun, Steinbach und Eiterfeld kam es in den Jahren 1843 bis 1850 durch bäuerlichen Mob zu gewalttätigen Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung. Angesichts der Verwüstungen ihrer Häuser, Plünderungen, Drohungen, die Häuser in Brand zu setzen, tätlichen Übergriffen und Morddrohungen mussten die Juden um ihr Leben fürchten. Nur mit Hilfe von Bürgergarden und Nachtwachen bis zum Einsatz von Militär konnte Schlimmeres verhindert werden.
In Fulda war die Teilhabe an der bürgerlichen Gesellschaft neben dem politischen und militärischen Engagement auch im Kulturellen, so im Bürgerverein „Gesellschaft Fuldaer Bürger“ zu sehen. In dem Verein, der sich die „Beförderung der geistigen Ausbildung und des geselligen Vergnügens“ zur Aufgabe gemacht hatte, waren circa 10 Prozent der 230 Mitglieder im Gründungsjahr 1832 jüdisch. Versammlungsfreiheit Zeitungslesen, offener Gedankenaustausch und Stellungnahmen hatten durchaus politischen Charakter und waren in der Zeit des Vormärz ein wichtiges Element der Herausbildung demokratischen Bewusstseins.
Die militärische Niederschlagung der bürgerlichen Revolution von 1848/49 und die Auflösung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche bedeutete auch ein Rückschlag für die Emanzipation des hessischen Judentums. In der neuen Verfassung für das Kurfürstentum Hessen von April 1852 wurde die Wahrnehmung bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte vom christlichen Glaubensbekenntnis abhängig gemacht. Damit wurden die Errungenschaften der kurhessischen Verfassung von 1833 zurückgenommen und die Juden erneut zu Bürgern 2. Klasse herabgestuft. In der Folge musste der 1851 in den Bürgerausschuss gewählte Hirsch Epstein wieder aus dem Stadtparlament ausscheiden. Erst zehn Jahre später wurden in Kurhessen im Mai 1863 die Ausnahmegesetzte für Juden aufgehoben und ihnen auch in Fulda die bürgerliche Gleichberechtigung wiedergegeben. +++ Dr. Michael Imhof
Zitate und Text nach: Michael Imhof, Der langwierige Weg der Fuldaer Juden in die Emanzipation. Stationen der rechtlichen Gleichstellung der Juden in Fulda im 19. Jahrhundert, in: Geschichtsblätter. Zeitschrift des Fuldaer Geschichtsvereins Jg. 90/2014, S.39-78.